Desinteresse an öffentlichen Angelegenheiten, Rückzug ins Private, Wahlmüdigkeit, Parteienverdruss, wachsende Skepsis gegenüber Demokratie und Staat – solche Phänomene der Entpolitisierung werden von der herrschenden politischen Klasse gerne wortreich bedauert und als bedenkliche Krisensymptome gedeutet. Das politische Führungspersonal versichert treuherzig, es verfolge solcherart Lethargie mit großer Sorge und wolle ihren Ursachen auf den Grund gehen. Denn es könne keine Demokratie ohne Demokraten geben. Daher wünsche man sich selbstverständlich und dringend den aktiven Bürger, den interessierten Zeitgenossen, der am politischen Geschehen Anteil nimmt, der sich einbringt und mitmacht.
Ein Standpunkt von Ulrich Teusch.
Sonderlich glaubhaft sind solche Beteuerungen nicht. Denn zum einen trägt die real existierende Politik durch ihr Gebaren einiges dazu bei, Menschen in die politische Apathie oder Resignation zu treiben, zum anderen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie recht gut mit apathisch-resignierten Bürgern leben kann – besser jedenfalls als mit unbequem-aktiven.
Sollte es da also einzelne politikverdrossene Mitbürger geben, die ihren politischen Rückzug mit irgendwelchen konstruktiven Hintergedanken verbinden, zum Beispiel mit der Hoffnung, sie könnten durch ihre Verweigerungshaltung – etwa konsequente Wahlabstinenz – „Druck aufbauen“ und „etwas bewirken“, dann befinden sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Holzweg. Ein Legitimationsentzug dieser Art kratzt „die da oben“ kaum bis gar nicht.
Was zur Frage führt: Gibt es alternative Handlungsoptionen? Kann man sich der etablierten Politik auf andere, effektivere Weise verweigern? Und zwar so, dass die Politik den Rückzug nicht einfach aussitzen oder ignorieren kann, sondern die Herausforderung annehmen und reagieren muss? Eine mögliche Lösung des Dilemmas: Man müsste es schaffen, die gerade beschriebene passive Verweigerung in eine aktive umzuwandeln. Es käme darauf an, eine bloß un-politische Haltung durch eine anti-politische zu ersetzen.
Antipolitik, antipolitisch – diese Begriffe haben in den öffentlichen Debatten Seltenheitswert. Und sie sind, wenn sie doch einmal auftauchen, in aller Regel negativ konnotiert. Während unpolitische Menschen nicht weiter ernst genommen werden – sie gelten als die schweigenden Lämmer, naiv, harmlos, leicht steuerbar –, sieht man in antipolitischen eine Gefahr: Sie stören, sind unberechenbar und bedrohlich.
Das kann nicht verwundern. Denn: Antipolitik ist eine spezifische Form der Fundamentalopposition. Sollte sie irgendwann nicht mehr bloß eine kleine radikale Minderheit beseelen, sondern zu einem Massenphänomen werden, wäre sie geeignet, das politische Establishment in Angst und Schrecken zu versetzen. Was also hat es mit Antipolitik auf sich? Wo kommt sie her? Gegen welche Art von Politik richtet sie sich? Was ist ihr Sinn und Zweck?
György Konrád als Wegweiser
Es geschieht selten, dass sich Menschen explizit zu einer antipolitischen Haltung bekennen. Das realsozialistische Osteuropa der 1970er und 80er Jahre bildete eine Ausnahme. Antipolitisches Denken und Handeln spielte unter den dortigen intellektuellen Regimekritikern eine prominente Rolle. Und wohl keiner der zahlreichen Dissidenten hat so bewusst, so reflektiert antipolitisch gedacht und gelebt wie der ungarische Schriftsteller György Konrád (1933-2019). Im Leben Konráds verschmelzen antipolitische Theorie und Praxis. Wer sich antipolitische Möglichkeiten erschließen will, tut daher gut daran, beim Leben und Werk dieses widerständigen Menschen anzusetzen.
Konrád hat in seinem Leben beides kennengelernt, Diktatur und Demokratie. Nur mit großem Glück ist er der Ermordung der ungarischen Juden durch die Nationalsozialisten entronnen. Auch mit der kommunistischen Diktatur, die sich in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Heimat etablierte, geriet er schon bald überkreuz. Nach dem gescheiterten Volksaufstand des Jahres 1956 stand die ungarische Grenze für kurze Zeit offen. Konrád hätte sein Land verlassen können – wie viele andere, wie viele seiner Freunde. Auch später noch hätte er Auslandsaufenthalte nutzen können, um Ungarn Adieu zu sagen. Doch er ließ alle Gelegenheiten verstreichen.
Geblieben ist Konrád nicht, weil er für das kommunistische Regime in Budapest irgendwelche Sympathien hegte. Im Gegenteil, im Lauf der Jahre wurde er zu einem der bekanntesten und publizistisch rührigsten Dissidenten des Sowjetblocks. Sein Entschluss, in Ungarn auszuharren, bedeutete für ihn eine Zeit schwerer Entbehrungen, Schikanen und Demütigungen, eine Zeit dauernder existenzieller Unsicherheit.
„Mit zwölf hatte ich den Nationalsozialismus überlebt. Mit fünfzehn erlebte ich das Jahr der kraftstrotzenden Einführung des Kommunismus. Zusammen mit ihm bin ich älter geworden, Jahrzehnte sind in aktiver und disziplinierter Resignation verstrichen, und ich war bereits sechsundfünfzig, als das Regime zu Grabe getragen wurde. Meine besten Jahre hatte ich im Schatten von Dummheiten verbracht. Fast nie konnte ich mich vom Gefühl des Eingesperrtseins befreien, dennoch entschied ich mich nicht dafür, von weitem auf dieses Land, mein Land, zu blicken. Mich krümmend, streckend bewegte ich mich tastend voran.“
Im eigenen Land persona non grata, war Konrád im Westen ein bekannter Autor, dem es immer wieder gelang, Manuskripte über die Grenze zu schmuggeln und auf diese Weise lebensnotwendige Einnahmen zu erzielen. Aber er musste lernen, sich in Bescheidenheit zu üben, etwaige materielle Ansprüche deutlich zu reduzieren.
Um eine Rückkehr ins normale Berufsleben bemühte er sich nicht. „Meinem Naturell entsprechend“, so Konrád, „war ich ein Bürger. Dissident bin ich nur gezwungenermaßen geworden.“ Er ließ sich nicht ködern, war zu keinem Kotau bereit, verweigerte die untertänige Bitte um Wiederaufnahme in den Pferch. Konrád legte eine Haltung an den Tag, die für die Gegenseite ungewohnt war und mit der sie nicht souverän umzugehen wusste.
„Die Eingeweihten in der alten Ordnung konnten sich nur schwer vorstellen, daß der Aussteiger nicht damit rechnete, bei passender Gelegenheit seinen Platz im System wieder einzunehmen, am besten auf einem höheren Posten als zuvor, sondern daß er sich aus eigenem Antrieb anstelle des öffentlichen Dienstes für den Dienst im zivilen Leben entschieden hat. Nach Regierungsrepräsentation, -ansehen und –pfründen verlangte es mich ebensowenig wie nach Rückenschmerzen.“
Konrád hat über seine Haltung schon früh auch theoretisch reflektiert und sie mit dem Begriff „Antipolitik“ belegt.
„Eines Nachts in den achtziger Jahren hastete Gábor Demszky mit schweren Papiersäcken über der Schulter die Treppe hinauf, ein wenig keuchend brachte er mir die frisch hektographierten Exemplare meines Buches Antipolitik. In dem heimlich geschriebenen und publizierten Essay war davon die Rede, daß die Zeit gekommen sei, den Eisernen Vorhang friedlich zu beseitigen, daß es mit dem Dialog der Raketen reiche, daß nun die Europäer die Sache in die Hand nehmen müßten. Nach den niedergeschlagenen Freiheitsversuchen in Budapest, Prag und Warschau seien nun Moskau und Berlin an der Reihe. Die russischen Soldaten sollten nach Hause gehen, und zurückkommen sollten die russischen Touristen.“
Dämme gegen die politische Flut
Antipolitik, so hatte ich gesagt, sei Fundamentalopposition gegen die jeweils dominante Politik. Entsprechend den Eigenarten des politischen Systems, in dem (und gegen das) sie praktiziert wird, kann sie daher Unterschiedliches bedeuten. Nur: Prinzipiell politikfeindlich oder auch nur apolitisch ist sie nie. Und politikfeindlich oder apolitisch ist auch Konrád nie gewesen. Über viele Jahre war er ein gefragter Essayist, der sich immer wieder einmischte, der sich gerne und pointiert zu politischen Themen äußerte.
Zu Zeiten des kommunistischen Ungarn hieß Antipolitik: Friedlicher, subversiver Kampf gegen die „Politisierung von oben“, wie sie von der Partei- und Staatsmacht betrieben wurde. Es ging darum, gesellschaftliche Teilbereiche von ihrer staatlichen, politischen, ideologischen Durchdringung zu befreien, ihnen Autonomie zurückzugeben. Will man es paradox formulieren, kann man sagen, dass der Antipolitiker Konrád eine „Politik der Entpolitisierung“ betrieb.
Antipolitik ist demzufolge keine politische Richtung, die einer anderen Richtung den Kampf ansagt und selbst nach politischer Macht strebt. Antipolitik versucht vielmehr, ein dominantes Politikverständnis durch ein ganz anderes zu ersetzen. Anfang der 1980er Jahre schrieb Konrád:
„Da uns die Politik in fast allen Ecken und Enden des Lebens überschwemmt hat, wünsche ich mir den Rückgang der Flut. Wir müssen unser Leben entpolitisieren, wir müssen uns von der Politik befreien wie von einer Heuschreckenplage.“
Und weiter:
„Antipolitik ist das Politisieren von Menschen, die keine Politiker werden und keinen Anteil an der Macht übernehmen wollen.“ „Antipolitik heißt Scharfblick. Unauslöschlicher Argwohn gegen die uns umgebende Menge politischer Urteile.“ „Die Antipolitik ist weder Stütze noch Opposition der Regierung, sie ist anders.“
Mit solchen Maximen sprach Konrád vor allem die Intellektuellen an. „Die Macht des Geistes und die Macht des Staates sind miteinander unvereinbar“, versicherte er. Und mit Blick auf die Künstler fügte er hinzu: „Echte Kunst kann nicht Dienerin einer Regierung sein, stets ist sie etwas anderes als von den Herrschenden gewünscht.“
Obwohl sich die politischen Verhältnisse in Ungarn und andernorts nach dem Ende des Ost-West-Konflikts grundlegend verändert haben, verstand sich Konrád auch im Nachfolgesystem – und offenbar mehr denn je – als Antipolitiker. Er hat seine Haltung sogar zu einer allgemeinen Lebenseinstellung radikalisiert, zu einer Philosophie der Gelassenheit, der geistigen Souveränität, der ironischen Distanz.
Zudem richtete sich sein stets unberechenbares, skeptisches Denken, Schreiben und Handeln nicht mehr allein gegen die maßlose Politisierung von oben, sondern auch gegen jede ausufernde Politisierung von unten, also gegen die Selbst-Politisierung der Gesellschaft. Konráds Antipolitik stufte das Politische zu einem Lebensbereich neben vielen anderen, nicht minder wichtigen Lebensbereichen herab und grenzte es insbesondere scharf von allem Privaten ab. Antipolitik ist die Suche nach einem dritten Weg zwischen Politisierung und Privatisierung. Ein Antipolitiker agiert zwar auf subtile Weise politisch, doch er ist weit davon entfernt, sich als homo politicus oder als „political animal“ zu verstehen.
Traditionslinien
Einstellungen und Maximen dieser Art sind selbstverständlich keine Erfindung osteuropäischer Dissidenten. Der Streit darüber, was Politik ist oder sein sollte, ist über zwei Jahrtausende alt. Von der klassischen Position der antiken Philosophie, die Mensch und Bürger in eins setzte und die politische Beteiligung als die zentrale Bestimmung, als das Wesensmerkmal des Menschen ansah, haben sich über die Jahrhunderte immer wieder andere Denkströmungen nachdrücklich distanziert. Schon dem augustinischen Denken wie auch viel später dem anarchistischen galt die Politik im Grunde als Übel. Auch Marx und der Marxismus wollten Politik letztlich überwinden; die für Klassengesellschaften typische (politische) Herrschaft von Menschen über Menschen sollte in der kommunistischen Zukunftsgesellschaft durch eine herrschaftsfreie (und damit unpolitische) „Verwaltung von Sachen“ abgelöst werden.
Der Liberalismus war bestrebt, Politik in Rechtsverhältnisse aufzulösen und gesellschaftliche Teilbereiche – in Sonderheit die Ökonomie – der Selbststeuerung zu überlassen beziehungsweise politische Eingriffe auf ein Minimum zu beschränken. Schließlich ist da noch die epikuräische Haltung. Auch sie weist der Politik eine Sonderfunktion und einen eher bescheidenen Platz zu. Ihre wesentliche Aufgabe sieht sie darin, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, damit sich die Bürger – weitgehend unbehelligt von politischen Nachstellungen – ihren Neigungen ungestört hingeben und ihrer individuellen Vervollkommnung widmen können. Antipolitisches Denken kann an all diese skeptischen Traditionslinien anknüpfen – und unterscheidet sich doch von ihnen.
Abwegige Vorwürfe
Ihre Kritiker werfen antipolitischen Denk- und Handlungsansätzen gelegentlich vor, sie lebten von einer ausdrücklichen, bewussten und bedachten Absage an die Politik als solche. Sie weigerten sich anzuerkennen, dass Politik ein unverzichtbarer, notwendiger Teil und Ausdruck der conditio humana sei, und dass die Gründe und Voraussetzungen für Politik in der unaufhebbaren Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Meinungen, Interessen und Lebenspläne lägen. Weil sie all dies letztlich nicht wahrhaben wolle, manövriere sich Antipolitik in eine unhaltbare, rigoristische Position. Sie formuliere Ziele, die nicht erreichbar seien. Sie habe sich den Kampf gegen das Politische schlechthin auf die Fahnen geschrieben und wolle den unvermeidlichen Zumutungen der Politik, der mühsamen Sisyphosarbeit des politischen Alltags, ein für allemal den Garaus machen.
Vorwürfe dieser Art sind abwegig. Antipolitik ist keineswegs eine rigoristische Absage an die Politik als solche. Kein Verfechter eines antipolitischen Ansatzes würde behaupten, dass wir auf jedwede Politik verzichten könnten. Im Gegenteil: Wir haben keine Wahl zwischen Politik und Nicht-Politik – weder bei uns noch anderswo. Und das heißt: Man kann in einem strengen, prinzipiellen Sinne nicht „gegen Politik“ sein, ebenso wenig wie man gegen andere für das Menschsein konstitutive Phänomene sein kann: etwa Technik, Kunst oder Kommunikation.
Eine antipolitische Haltung, verstanden als rigide Ablehnung jeglicher Politik, also der Politik als einer menschlichen Handlungsform und eines gesellschaftlichen Handlungsbereichs, ist theoretisch nicht begründbar und praktisch zum Scheitern verurteilt. In einer notwendigerweise politischen Welt wäre selbstverständlich auch jede prinzipielle Ablehnung von Politik noch ein politischer Akt. Insofern gibt es kein Entkommen.
Wesentlich interessanter wird es jedoch, sobald man sich unterhalb dieser prinzipiellen Schwelle bewegt. Hier lässt sich nämlich sehr wohl sinnvoll von Antipolitik sprechen, hier lässt sie sich auch praktizieren, hier ist sie nicht länger eine ans Absurde grenzende Verweigerung, sondern eine durchaus plausible Haltung.
Denn: Antipolitik richtet sich nie gegen die Politik schlechthin, sondern immer gegen unerwünschte oder bedrohliche Ausprägungen einer ganz bestimmten, konkreten Politik. Vor allem richtet sie sich gegen ein Zuviel an Politik, gegen anmaßende Politik. Oder anders: Sie baut Dämme gegen die Flut politischer Zumutungen. Sie weist Politik in ihre Schranken. Sie beseitigt politische Umweltverschmutzungen. Sie wehrt sich nicht gegen den Staat, sondern gegen den Etatismus, nicht gegen die Politik, sondern gegen die exzessive Politisierung.
Antipolitiker lassen sich nicht von billigen Ressentiments leiten. Sie sind politisch informiert, und sie verfügen oft über erhebliche politische Erfahrung. Sie wissen also sehr genau, wovon sie sprechen. Sie wissen, wofür und wogegen sie sind. Sie sind, paradox ausgedrückt, antipolitische Politiker. Sie greifen in die Politik ein, indem sie sich dem üblichen politischen Spiel verweigern, indem sie ihre eigenen Regeln setzen, ihre eigenen Wege gehen. Sie irritieren und verunsichern die etablieren Mächte. Auch dadurch, dass sie deren Lockspeisen verschmähen, deren Geschenke nicht annehmen.
Realistischer Politikbegriff
Insbesondere stemmen sich Antipolitiker gegen jegliche Verklärung von Politik. Sie wehren sich gegen die Lobredner der Politik, die ein geschöntes Bild präsentieren, die suggerieren oder explizit behaupten, dass Politik eine dem menschlichen Fortschritt dienliche, zivilisatorische Funktion erfülle. Es mag zwar sein, sagen sie, dass eine stabile politische Herrschaft einem Hobbes‘schen Naturzustand grundsätzlich vorzuziehen ist. Aber der hurtige Umkehrschluss führt in die Irre: dass die Etablierung von politischer Herrschaft ein zunehmend zivilisiertes Zusammenleben befördere oder sogar garantiere.
Politik im globalen Maßstab ist weit von dem entfernt, was wir in demokratischen Schönwetterphasen hier und da erleben oder erlebt haben. Statt die Politik auf neuere Erfahrungen aus westlichen Verfassungsstaaten zu verengen und sie auf diese Weise zu beschönigen, sollte man sie als das sehen, was sie über Jahrtausende immer auch und vor allem gewesen ist. Sie war nicht nur ein Mittel, um das Raubtier Mensch, das seinen Artgenossen das Leben streitig macht, zu domestizieren, sondern auch ein Mittel, diesem Raubtier zur Macht zu verhelfen und seine Raubzüge zu legitimieren.
Wäre da tatsächlich eine Fortschrittstendenz im politischen Leben zu erkennen, hätte sie sich ja wohl in den Epochen nach der Aufklärung und spätestens im 20. Jahrhundert auf irgendeine Weise manifestieren müssen. Doch das hat sie nicht getan – im Gegenteil. Das 20. Jahrhundert hat den höchsten Blutzoll in der bisherigen Menschheitsgeschichte gefordert – in Kriegen und Bürgerkriegen, durch Völkermord und staatliche Unterdrückung. György Konrád:
„Die herrschenden Ideen des zwanzigsten Jahrhunderts waren ausnahmslos mörderisch, obwohl dies ursprünglich keine einzige sein wollte. (…)
Im allgemeinen sind die Ereignisse der Geschichte gleichbedeutend mit dem gewaltsamen Tod vieler Menschen. Gemordet hat die Rechte, und gemordet hat die Linke. Gemordet worden ist in der Nähe, und gemordet worden ist in der Ferne. Sämtliche nationalistischen Bewegungen haben gemordet, einige von ihnen über die Maßen fleißig. Gemordet haben die Reichen, und gemordet haben die Armen, gemordet haben die Alten, und gemordet haben die Jungen. Die Frauen und die Kinder haben verhältnismäßig wenig gemordet.
Niemand von denen, die in der ersten Person Plural geredet haben, ist unschuldig. Selbst die Gesellschaft der Schriftsteller kann auf eine ziemlich hässliche Vergangenheit zurückblicken, begabte Autoren haben die verschiedensten Schändlichkeiten gerechtfertigt, beschönigt oder durch ihr Schweigen zumindest unterstützt.“
Gibt es irgendwelche Hinweise, dass sich daran im 21. Jahrhundert etwas ändern könnte?
Antipolitik in der Coronakrise
Die politischen Ereignisse des vergangenen Jahres, also der repressive staatliche Zugriff auf Individuen und Gesellschaft, kamen für viele Menschen überraschend. Sie zeigten, wie prekär die großen rechtsstaatlichen und demokratischen Errungenschaften in Wahrheit sind. Das schnelle und robuste staatliche Handeln wirkte weithin schockierend und lähmend – und doch auch als Augenöffner. Es mag sogar sein, dass in Deutschland inzwischen die Hälfte der Bevölkerung den Umgang der Bundes- und Landesexekutiven mit der „Coronakrise“ kritisch oder skeptisch beurteilt.
Doch ist es damit getan? Was folgt aus solcher Einsicht? Milosz Matuschek liegt richtig, wenn er postuliert:
„Es wird kein Retter kommen. (…) Es wird niemanden geben, der für den Einzelnen die Arbeit macht. (…) Alles hängt gerade davon ab, ob sich die Gesellschaft selbst organisieren kann und einen gemeinsamen Willen zu bilden vermag. Gegen Machtkonzentration, Technokratie, Korporatismus und Planungszentralismus hilft nur die organisierte Kraft dezentral agierender Individuen. Es wird Zeit, dass der Bürger die Strukturen seiner Lebenswelt selbst in die Hand nimmt. Gegen korrupte Regierungen hilft nur, daran zu arbeiten, unregierbar zu werden.“
Das ist ein Aufruf zu antipolitischem Denken und Handeln. Doch die Gesellschaft ist gespalten, und ansprechbar für das antipolitische Projekt ist nur eine Minderheit, in einer optimistischen Schätzung vielleicht zehn oder fünfzehn Prozent der Bevölkerung. Diese Minderheit müsste aber jetzt, spätestens jetzt damit beginnen, mit Bewusstsein und Entschiedenheit Antipolitik zu betreiben. Sie müsste leben „als ob“ – als ob die Gesellschaft schon so wäre, wie sie irgendwann einmal werden könnte oder zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht gewesen ist. Sie müsste sich in den verbliebenen Refugien zusammenfinden, in Parallelgesellschaften, in Subkulturen, in „Freundesnetzen“, wie sie György Konrád einst beschrieben hat:
„Frieden (…) ist nicht nur die augenblickliche Abwesenheit von Krieg, sondern etwas mehr, etwas Zuverlässigeres, nämlich Freundschaft, eines der höchsten menschlichen Güter. Zur Liebe genügt ein einziger Mensch, zur Freundschaft aber bedarf es auch eines anderen. Freundschaft ist eine wechselseitige Beziehung. Ich kann sogar mehrere Freunde haben, und es ist auch denkbar, daß die zusammenkommen. Dann kann eine einzige Person Knotenpunkt eines ganzen Freundesnetzes sein. (…)
Eine gute Gesellschaft ist durch viele paarweise oder in Gruppen sich manifestierende freundschaftliche Beziehungen miteinander verbunden.“
Netzwerke dieser Art sind heute nötiger denn je – und auch sie haben ihre großen Vordenker. In seinem epochalen Werk Über die Demokratie in Amerika beschrieb Alexis de Tocqueville (1805-1859) eine soziale und politische Entwicklung, an deren Ende, wie er fürchtete, ein übermächtiger Staat stehen könnte, der sich über eine große Masse atomisierter, dem direkten staatlichen Zugriff ausgelieferter Individuen erheben würde. Als mögliche Gegenmaßnahme schlug Tocqueville die Stärkung intermediärer Instanzen und freier Assoziationen vor, also zum Beispiel lokaler partizipatorischer Praktiken oder regionaler Kulturen, die den Einzelnen Schutz vor dem staatlichen Zugriff und freie Entfaltungsmöglichkeiten bieten sollten.
Diese von Tocqeville als Gegengewichte oder Gegenprinzipien ins Spiel gebrachten Kräfte entstammen einem antipolitischen Kontext. Und solcherart Antipolitik sorgt für Dialektik. Sie erzeugt fruchtbare Spannungen. Sie streut auf ebenso subversive wie konstruktive Weise Sand ins Getriebe der politischen Formierung. Sie stellt sich gegen die technokratisch-zentralistischen Trends und entfaltet beharrende, retardierende, mäßigende Wirkungen.
Wie überlebt man in einer Welt, in der man sich fremd fühlt und der man sich zunehmend entfremdet? Antipolitik könnte ein Antidot sein. Antipolitik ist – in letzter Instanz – eine Reise zu sich selbst. Sie ist der Wunsch, endlich in Ruhe gelassen zu werden. Sie ist die Sehnsucht nach Heimat. György Konrád:
„Wo ist Heimat? Wo ich nicht totgeschlagen werde. Wo ich meine Kinder in Sicherheit weiß. Wo es Achtung gibt vor der Person und dem Wort. Wo das, wie ich bin und was ich denke, mit einem Vorschuß an Billigung bedacht wird. Wo es eine ruhige Küchenecke gibt, in der man sich nach dem Abendbrot bei einen Glas Wein gut unterhalten kann. Wo die Kinder Verstecken spielen und Bunker bauen. Wo Jutka mit hochgezogenen Beinen in einem Sessel sitzt und liest. Wo ich beim Besteigen des Berges sowohl hier als auch da ein Glas Wein trinken könnte und mich hüpfend abwärts bewegen würde, wenn ich alle freundlichen Einladungen annehmen würde.
Heimat ist mitten auf der Elisabethbrücke, wenn ich von meinen Reisen zurückkehrend bei mir sage: ‚Wie schön!’ Und Heimat ist dort vor einem von Wildem Wein berankten Haus, wo ich den Torschlüssel hervorsuche und mit je einer Tasche über beiden Schultern hinauf in den zweiten Stock gehe, ein wenig keuche und von drinnen Stimmen höre, sehr lebhafte Stimmen. Ich bin angekommen.“
Die hier verwendeten Zitate György Konráds entstammen seinem autobiographischen Roman Sonnenfinsternis auf dem Berg (Suhrkamp 2005) sowie einigen seiner Essaybände, u.a. Die unsichtbare Stimme (Suhrkamp 1998) und Der dritte Blick (Suhrkamp 2001).
+++
Die Bücher „Krieg vor dem Krieg“ und „Lückenpresse“ von Prof. Dr. Ulrich Teusch werden in diesem Zusammenhang empfohlen.
+++
Dieser Beitrag erschien zuerst am 25. Februar 2021 im Magazin multipolar.
+++
Danke an den Autoren für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Bildquelle: Elena Berd/ shutterstock
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
KenFM unterstützen mit FLATTR: http://bit.ly/KenFM-Flattr
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

Bitcoin-Account: https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten findest Du hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
Antipolitik antipolitische Theorie Apathie Coronakrise Diktatur und Demokratie. Diktaturansätze Dissident Entpolitisierung Fundamentalopposition György Konrád Handlungsoptionen kommunismus kommunistische Diktatur Multipolar öffentliche Debatten Ost-West-Konflikt Partei- und Staatsmacht b Politik der Entpolitisierung Politikbegriff Politikverständnis Resignation schikanen Schweiger der Lämmer Verweigerungshaltung Volksaufstand Wahlabstinenz Warum schweigen die Lämmer








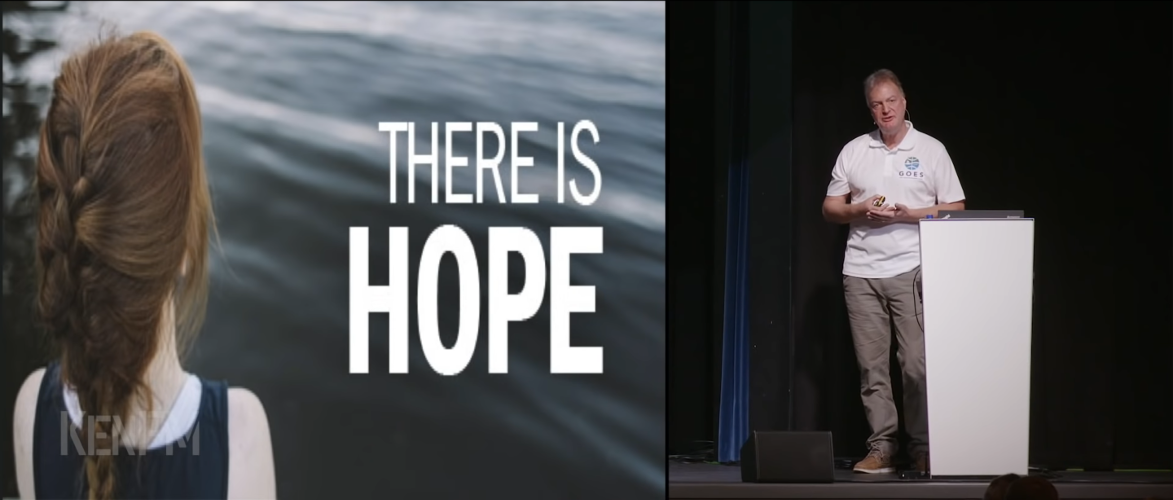
Kommentare (12)