Von Susan Bonath.
Mangelnde Einsicht, keine Ziele, fehlende Konsequenzen: Soziale Versprechen der Linken laufen systemkonform ins Leere. Das rächt sich in rechten Massenbewegungen.
Laut, chauvinistisch und neoliberal kommt sie daher, mal übertüncht mit blondlockig bebilderten christlichen Fundamentalfantasien, häufiger in plumpe »Merkel muss weg«-Parolen verpackt, meistens gepaart mit unverhohlenem Geschrei nach Rassenreinheit auf deutschem Boden: Die AfD.
Mit den Interessen der Lohnabhängigen hat ihr flatterhaft populistisches Heischen nach Parlamentsposten so wenig zu tun,wie der Jahresgewinn der BMW-Milliardärsfamilie Quandt. Und trotzdem ist die AfD, 2013 entsprungen aus dem Nährboden wohlhabender Unternehmer mit CDU-Parteibuch und Eurofrust, gedüngt mit dem Feindbild des verlustängstigen Bürgertums und einer wütenden Unterschicht namens Migrant, beliebtes Ziel für das Urnenkreuz aus Arbeiterhand. Das zeigten zahlreiche Wahlumfragen in diesem Jahr.
Dass Arbeiter gegen ihre Interessen wählen, ist nichts Neues. 140 Jahre Kreuze bei der SPD – die schon um 1890 mit den Eliten kungelte – haben kaum einen armen Schlucker von der Armut befreit. Auch die als Arbeiterpartei verkleidete Faschistenpartei NSDAP verriet selbige im Eiltempo auf mörderischste Weise.
Die rechten Populisten, mal leise, mal laut, mal brüllend, gewinnen dieser Tage nicht nur in Deutschland an Zulauf. In den USA, wo 60 Millionen Menschen von Lebensmittelmarken leben und Milliardär Donald Trump das Feindbild »Wirtschaftsflüchtling« in fernsehsüchtige Geringverdienerhirne hämmert; in Frankreich, wo der Front National soziale Forderungen mit strikter rassischer Ausgrenzung armer Schlucker aus Süd und Ost vermengt, oder in der zerrütteten Ukraine, wo Faschisten ruckzuck das Oberwasser auch im Unterschichtsmilieu errungen hatten, sieht es nicht besser aus.
Verschleierte Verhältnisse
Warum die rechte Bugwelle rollt und stärker wird, warum es in Deutschland ausgerechnet eine AfD mit einer gruseligen Mischung aus CDU-, FDP- und NPD-Parolen im Parteiprogramm in die Charts schafft, obwohl nicht sie, sondern die Linke sämtliche Interessen der Lohnabhängigen, wie höhere Gehälter und Sozialleistungen, auf ihrer Forderungsliste vereint, ist nicht schwer zu erraten.
Die Rechten rufen laut und flirrend populistisch in die Masse, ihre Propaganda ist – bis auf den Rassismus – wandelbar wie ein Chamäleon. Munter vermengen sie, je nach angesprochener Klientel, Richtiges (Kritik am Euro, der Bundesregierung, den USA, manchmal sogar an NATO-Kriegen) mit Falschem (Verschleierung der Verhältnisse durch ethnische Ab- und Aufwertungen sowie der Verklärung von deutscher Ober-, Mittel- und Unterschicht zu einem Einheitsbrei mit angeblich gleichen Interessen).
Das Problem bleibt manifest: Die AfD will selbst erklärt ein paar Politikern, nicht aber den Eliten an den Kragen. Kapitalbesitz auf der einen und Lohnarbeit auf der anderen sollen bitte schön erhalten bleiben. Penetrant wiederholt sie dabei die neoliberale Mär: Geht es der Wirtschaft gut, wird genug für euch abfallen. Sie unterscheidet sich höchstens insofern von der CDU, als dass sie eine eher auf den eurasischen als den US-amerikanischen Markt orientierte Kapitalbesitzerfraktion vertritt. Ihre Führer fühlen die aktuelle Politik als Bedrohung, weil sie darauf setzt, in der imperialen Machtwelle der USA mitzuschwimmen, um zu profitieren.
Linke mimen derweil das Kaninchen vor der Schlange. Sie überschlagen sich mit moralischen Wertungen, kritisieren Rechtspopulisten, ohne klarzustellen, was denn »rechts« ist, und blenden die ökonomischen Bedingungen, Abhängigkeiten und Machtverhältnisse fast komplett aus. Sie reagieren mit aufgeschrecktem Gegenpopulismus auf Einzelsituationen, der Ursachen verschweigt, um dann sofort in einen Tiefschlaf zu verfallen. Sie reden viel, oft verschwurbelt, ihre Funktionäre schielen auf Posten. Mal ehrlich: Wer von denen, die zurecht frustriert sind, kann – nach der Agenda 2010, nach Zustimmung zu Kriegseinsätzen, Aufrüstung, Waffenexporten, CETA, … – noch für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis sein? Kurzum: Sie predigen Wasser, trinken Wein – aber sie agieren nicht.
Die AfD kann sich so getrost in ihrer Funktion des »schwarzen Ritters« zurücklehnen. Mit höhnischem Lachen und millionenschweren Werbekampagnen schubst sie die Etablierten von ihren Abgeordnetenposten in den Landtagen. Wer schwer enttäuscht und der Mär aufgesessen ist, Politiker, und nicht etwa jene, die das meiste Kapital in Besitz genommen haben und am effektivsten auf dem Rücken ihrer Beschäftigten zu Profit verwerten – kurz: die Eliten – hätten die Macht, wird darauf hereinfallen. Schließlich hat die Linke auch in Landesregierungen – Berlin, Brandenburg, Thüringen – so gut wie alle Vorabversprechen gebrochen.
»Rache der Proleten« gegen eigene Interessen
Die Linke hat sich die »Rache der Proleten« redlich erarbeitet. Es ist ein »Denkzettel« für ihren Verrat an den Besitzlosen, den Enttäuschten, den Geschröpften, die zu vertreten sie vorgibt. Ein Denkzettel für moralinsaure Pressemitteilungen, die so schnell verklingen, wie sie aus schicken Ledersesseln ins Internet hinein geblasen wurden. Mag dieser »Denkzettel« auch die falsche Antwort sein auf eine Linke, der zwischen Kaviar und Pragmatismus, zwischen Luftblasen und kaum durchsetzbaren »kleinen Schritten«, entgangen ist, dass ein Übel nicht zusammen mit dem Übel zu beseitigen ist.
Es bleibt dabei: Veränderungen durch ein Parlament herbeiführen zu wollen, das, an vorderster Front besetzt mit Zöglingen von Unternehmerclans und Dynastien alten Landadels, gar keine andere Aufgabe hat, als die Machtverhältnisse in diesem Staat per Recht und Gesetz zu erhalten wie sie sind, ist so aussichtslos, wie eine stabile Mauer mit einer Plastikschippe umzureißen.
140 Jahre Sozialdemokratische Arbeiterpartei, 26 Jahre PDS und Linkspartei: So viel ist klar: Irgendwann hat der geschröpfte »kleine Mann« keinen Bock mehr, gehorsam und demütig auf die nächste 20-Cent-Erhöhung seines Stundenlohns und am Ende auf eine Hungerrente zu warten. Das war schon immer so in der Geschichte und wird im 21. Jahrhundert nicht anders werden. Ist die Frustgrenze erreicht, ist es vorbei mit mit laschen Floskeln, wie dem üblichen Linkspartei-Slogan »Sozialabbau stoppen«. Dann müssen radikale Lösungen her, nicht von oben, sondern von unten, von der Straße, so gewaltfrei wie möglich, so gewaltsam wie nötig – ohne einen angsterfüllten Blick in die Gesetzesbücher der Herrschenden.
Scheitern vorprogrammiert
So klar, wie es ist, dass rechte Forderungen nach einem Rauswurf am besten aller Flüchtlinge ohne einen kompletten Stopp von Rüstung, Waffenexporten und Ressourcenraub nicht nur menschenverachtend sind, sondern keinem Abgehängten in den Industrienationen auch nur einen Euro mehr in die Tasche spülen, so klar ist allerdings auch: Ein linkes Programm wirklich durchzuziehen, geht nicht nebenher im Handumdrehen. Zu mächtig sind die Besitzenden, die Profiteure, die Bankiers, Großunternehmer, Finanziers, zu festgezurrt ihre Dogmen und Lügen, zu manifest der Run gegen das Verlieren und die Hoffnung auf Aufstieg.
Eindrucksvoll beweist das derzeit Syriza in Griechenland. Als Meister des linken Populismus eroberte Alexis Tsipras eine Mehrheit. Die neoliberale Presse verfiel in aufgeregtes Gezeter, als er tatsächlich, inmitten der für Griechenland besonders schlimmen Auswirkungen der Finanzkrise, den Chefsessel erklomm. Man darf Tsipras durchaus unterstellen, dass er es ernst meinte mit seinem Wunsch nach sozialen, ja sozialistischen Reformen, von Armutsbekämpfung über Arbeiterrechte bis hin zur Verstaatlichung ganzer Wirtschafts- und Finanzsparten. Doch wie wir wissen, kam es anders.
Die Eliten schliefen selbstverständlich nicht. Eine Umverteilung nach unten war mit ihnen nicht zu machen. Sie fuhren scharfe Geschütze auf. Ihren obersten »Zuhälter«, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, ließen sie ganz vorne tanzen, als Handpuppe ihrer exportstärksten Nation, jener, die in Europa die neoliberale Agenda vorgibt. Tsipras habe ihnen gefälligst zu folgen, um den Preis der Verelendung seiner Wähler. Die milliardenschweren Finanziers wollten Zinsen sehen. Die Drohungen reichten vom Rauswurf aus der EU bis hin zum Abschneiden aller Kapitalströme. Die Angst vor dem totalen Chaos ließ Tsipras einknicken: Löhne runter, Renten runter. Der Verlust der Binnenkaufkraft treibt die Massenarbeitslosigkeit die Spitze. Dafür bezahlen, wie überall, die Lohnabhängigen mit ihrer Lebensperspektive.
Das Ende dieses Weges ist längst nicht in Sicht: Erst vor wenigen Tagen stimmte große Teile von Syriza einem weiteren neoliberalen Reformpaket zu. Der massenhafte Ausverkauf griechischen Staatseigentums – Gas- und Wasserwerke, Autobahnen, Häfen – an finanzkräftige Privateigner steht bevor. Griechenland ist ein Schaubild für die Privatisierung unseres Planeten.
Was man Tsipras vorwerfen muss: Er ist klug genug, dass er wissen konnte, dass ein Staatschef in dieser Wirtschaftsordnung nicht die Macht hat, die Macht der Eliten zu brechen. Wer sich ans Buffet der Macht begibt, anstatt sich von unten gegen sie zu stellen, wird mittanzen müssen – oder zermalmt.
Hier liegt der Kern seines Verrats an all den Rentnern und Kindern, an den lohnabhängigen Müttern und Vätern, an den Erwerbslosen und sonstigen armen Schweinen, die er vertreten wollte. Tsipras´ Verrat ist das falsche Versprechen sozialer Verbesserungen über Regierung und Parlament. Der Verrat ist unterlassene Aufklärung seiner Wähler über die tatsächlichen ökonomischen Bedingungen. Was bleibt, ist ein gut bezahlter Posten für ihn und andere Syriza-Funktionäre und Perspektivlosigkeit für seine Wähler. Denselben Verrat begehen Podemos in Spanien, Linke in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und anderen Industriestaaten. Der Feststellung, dass Macht nicht gemeinsam mit der Macht zu brechen ist, müssen Konsequenzen gemeinsam den Abgehängten folgen. Sonst ist die Rache am Verrat gewiss.
Populismus, Aufklärung und Utopie
Wenn das Parlament als Konstrukt des von den Herrschenden geschaffenen Staatsapparats nicht taugt für revolutionäre Schritte, bleibt nur eins: Der Kampf um Köpfe und Herzen ist auf der Straße zu führen. Linker Populismus ist angesagt. Es gilt, Leute, die keinen Krieg wollen, zu überzeugen, dass es in allen Kriegen um ökonomischen Besitz, wirtschaftliche Macht und Profitinteressen geht. Es gilt, Leuten, die gegen Sozialabbau und Lohndumping sind, zu erklären, dass auch Verarmung die Folgen ökonomischer Kriege sind, die keineswegs ausschließlich mit Waffen und Panzern geführt werden.
Es gilt aber auch, der sogenannten Mittelschicht klar zu machen, dass ihre Bankguthaben nicht nach unten, sondern oben verschwinden – und dass auch dies dem Fortschreiten imperialer Machtkämpfe geschuldet ist. An jeder zerstörten Grünanlage, an jeder gebauten Autobahn, an jedem neuen Schießplatz der Bundeswehr, an jedem Luxusbahnhof und jeder Gehaltskürzung hat irgendwer verdient. Wir kommen um die Erkenntnis nicht drumherum: Das Grundproblem sind die Besitzverhältnisse.
Populismus braucht vor allem eins: Ein Ziel. Eine Utopie, die der Verstand erfassen kann, die vorstellbar ist – und die der derzeitigen Linken völlig abgeht. Eine »Utopie« bieten, wenngleich in Form so einfacher wie verlogener Lösungsvorschläge, die Rechten durchaus: Sie erheben die ethnisch angestammte Bevölkerung ihres Landes über den Rest der Menschheit, verklären sie zu einem Einheitsbrei, indem sie arm und reich leugnen. Sie lügen: Geht es der nationalen Wirtschaft gut, geht es euch gut – aber nur, wenn tausende Migranten euch nichts stehlen. Dass dies Blödsinn ist, beweisen die Zustände in Ostdeutschland seit der »Wiedervereinigung«. Auch fast gänzlich ohne Migranten fiel dort ein nicht geringer Teil der Lohnabhängigen durchs Raster. Fakt ist: Den Eliten sind Ethnien scheißegal. Ihnen geht es um Profit. Das Geschacher um bessere und schlechtere Sklaven nützt nicht unseren, sondern ihren Interessen.
Es bedarf einer Utopie, die mächtig werden und Solidarität bewirken kann, auch, weil sie auf Fakten beruht. Fakten sind: Wir produzieren Überfluss, der problemlos für alle reichen würde. Weil Maschinen mehr und mehr Arbeit übernehmen, wächst die Erwerbslosigkeit. Das ist nicht negativ, wie uns erzählt wird, sondern wunderbar. Teilte man die weniger werdende Arbeit gerecht auf, hätten alle viel mehr Freizeit – zum Garten beackern, nachdenken, Sprachen lernen, irgendwas erfinden oder einfach Spaß haben. Wir haben Computer, mit denen wir nicht nur Erdbeben vorausberechnen, sondern auch die Verteilung von Waren nach Bedarf koordinieren und Engpässe erfassen können. Wir können Waren transportieren, Geburten kontrollieren, verfügen über Verstand und ökologisches Wissen. Um all das nutzen zu können, ist eins Voraussetzung: Konzerne, Rohstoffe, Böden und alles, woraus sich Profit schlagen lässt, gehört nicht in private Hände.
Das löst bei manchem erregte Panik aus: Enteignung! Die eingebläuten Paradigmen vom gulag- und mauerbauenden, zähnefletschenden Kommunisten mit Stalinbüste auf dem Nachtschrank lassen den westlich indoktrinierten Hochschulabsolventen im Dreieck springen. Doch halt: Enteignung wäre es, wenn ein Privatbesitzer einem anderen was wegnimmt. Werden Betriebe oder Grundstücke der Allgemeinheit, also ihrem Zweck zugeführt – vielleicht verwaltet von gewählten Fachkommissionen? – bleibt der frühere Besitzer Mitbesitzer: Er kann die Waren nutzen, wie jeder andere auch, so. Er kann sie nur nicht länger gegen Gewinn verkaufen. Muss er auch nicht mehr. Weil er – endlich – an der gesamten Wirtschaft mit profitiert.
Ein weiterer Effekt: Niemand müsste mehr befürchten, kürzer als der Nachbar zu kommen, wenn jeder gleichermaßen Zugang zur produzierten Wertschöpfung hätte. Dieser wohl stärksten Triebkraft für Verbrechen und Korruption würde schlagartig der Nährboden entzogen.
Möglich wäre eine solche Wirtschaftsordnung. Man muss sie nur denken. Man muss sie wollen. Man muss es versuchen – bevor dieses endlose Gerangel um Macht, Profit und Herrschaft oben, und um Arbeitsplätze, Teilhabe und sozialen Status unten, uns allen den Boden unter den Füßen wegzieht.
Danke an die Autorin für das Recht zur Veröffentlichung des Artikels.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.


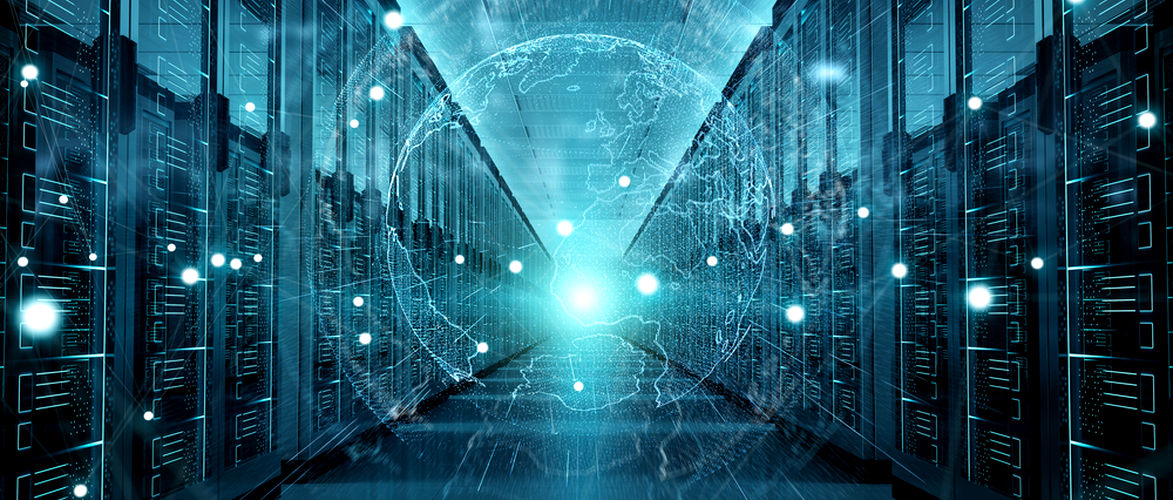







Kommentare (23)